Systemische Therapie
In den 1980er Jahren machte Helm Stierlin (Bild) die Systemische Therapie und die Familientherapie in Deutschland bekannt.
Mit Fritz B. Simon, Gunther Schmidt und Gunthard Weber u. a. gründete er
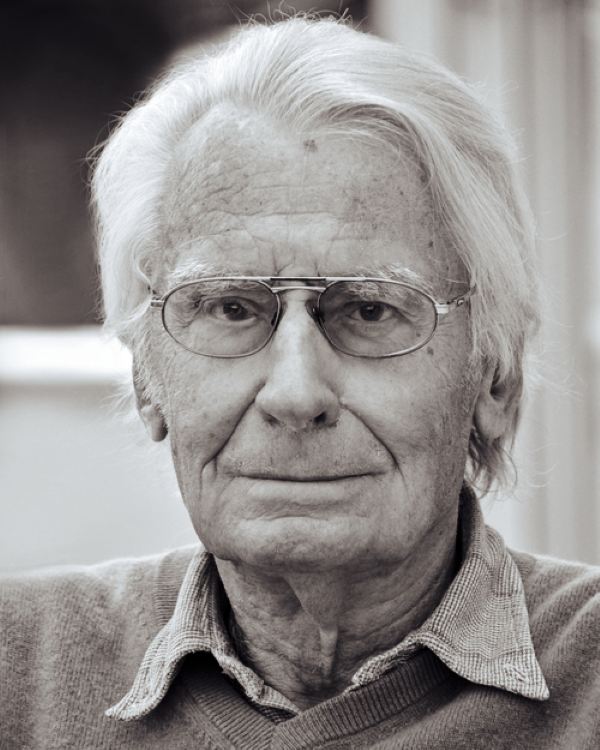 die bekannte „Heidelberger Schule“,
die maßgeblich die systemische Methodik im Land geprägt hat.
die bekannte „Heidelberger Schule“,
die maßgeblich die systemische Methodik im Land geprägt hat.
Hier wurden verschiedene Methoden und Techniken eingesetzt, integriert und weiterentwickelt und so hat diese Schule auch die aktuelle systemische Beratung,
Systemaufstellungsmethoden, hypnosystemische und narrative Methoden und andere Tools und Techniken mit hervorgebracht.
Symptome und Verhaltensmuster werden in der systemischen Therapie nicht einzelnen Personen zugeschrieben, sondern als Ausdruck von Beziehungs- und
Kommunikationsdynamiken im Gesamtsystem betrachtet. Auffälliges Verhalten wird nicht als „pathologisch“ angesehen, sondern als hilfreicher Verweis auf Störungen
im (Familien-) System. Therapieziel ist ein Gewinn an Wahlmöglichkeiten, um mehr Optionen für Verhalten, Wahrnehmung und Bewertungen zu haben.
⮞ Mehr zu Systemischer Therapie
Neurolinguistisches Programmieren – NLP
NLP kam Anfang der 1980er Jahre nach Deutschland und wurde schnell zur führenden Methode im Kommunikationstraining und später in Beratung und Coaching.
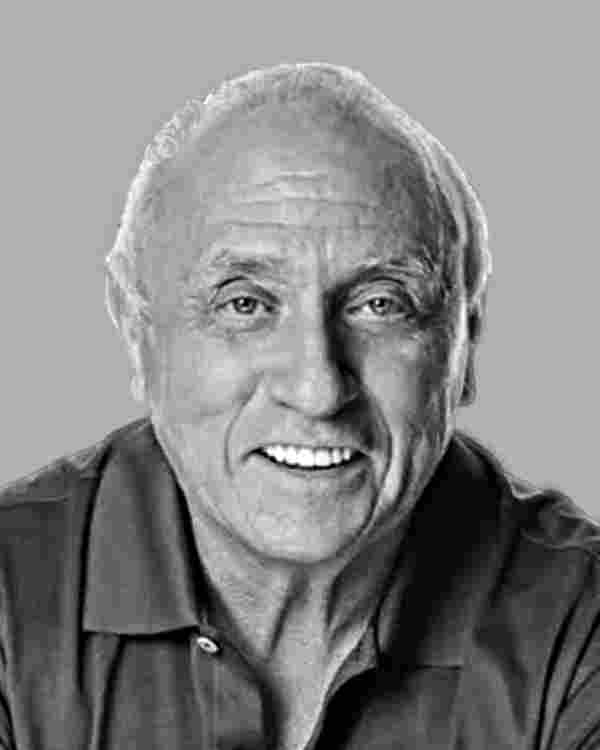 NLP wurde von dem Mathematiker Richard Bandler (Bild) und dem Linguisten John Grinder u. a. in den 1970er Jahren in Palo Alto entwickelt, sie wurden
dabei von Gregory Bateson gefördert. Sie definierten NLP als „das Studium über die Struktur subjektiver Erfahrung“.
NLP wurde von dem Mathematiker Richard Bandler (Bild) und dem Linguisten John Grinder u. a. in den 1970er Jahren in Palo Alto entwickelt, sie wurden
dabei von Gregory Bateson gefördert. Sie definierten NLP als „das Studium über die Struktur subjektiver Erfahrung“.
NLP ist eine Sammlung von Methoden und Techniken aus Therapie, Linguistik und Kommunikationswissenschaften auf der Basis von Konstruktivismus und Systemtheorie
und ein Modell, das zeigt, wie neuronale Prozesse sich in Wahrnehmung, Denken, Sprechen und Verhalten manifestieren und funktionale Strukturen und Muster
(Programme) bilden. Diese Programme lassen sich mit NLP-Techniken ändern, wenn Störungen, Veränderungs- oder Optimierungswünsche vorliegen.
Besonders bedeutsam sind m. E. das Wahrnehmungsmodell (VAKOG-Modell), das Meta-,
das Miltonmodell der Sprache und die Reframingformate des NLP.
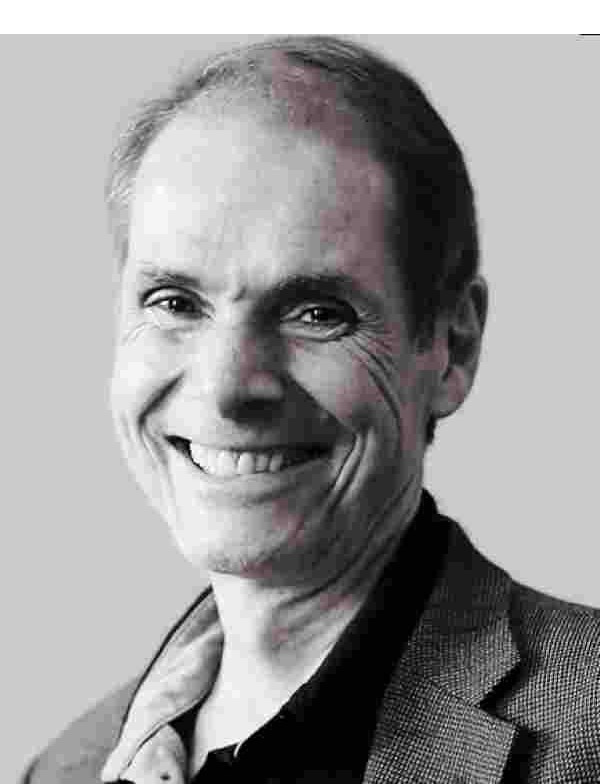 ⮞ Mehr zu NLP und den Anwendungen
⮞ Mehr zu NLP und den Anwendungen
Die Weiterentwicklung des NLP-Modells
Die Weiterentwicklung des NLP wurde von Robert Dilts (Bild), Judith DeLozier und vielen anderen betrieben.
Im Fokus sind dabei komplexere Systeme (Körper + Geist, Struktur der subjektiven Erfahrung), bis hin zu Verbindungen zur Spiritualität. Sehr bekannt
sind spezielle NLP-Formate von ihm wie die logischen Ebenen (Dilts-Pyramide) und das Re-Imprinting und die „Heldenreise“.
 Neue Ideen zur Ausweitung von NLP hat auch die promovierte Psychotherapeutin Connirae Andreas (Bild) zusammen mit ihrem Mann Steve Andreas
eingebracht. Bekannt ist vor allem die wunderbare Technik der Core Transformation und ihre Methode „The Wholeness Work“, die Selbstbetrachtung aus
verschiedenen Ebenen des Selbst ermöglicht. Beide Techniken können zu sehr tiefen und intensiven seelischen Prozessen, zu innerer Balance, Ruhe und Gelassenheit
führen.
Neue Ideen zur Ausweitung von NLP hat auch die promovierte Psychotherapeutin Connirae Andreas (Bild) zusammen mit ihrem Mann Steve Andreas
eingebracht. Bekannt ist vor allem die wunderbare Technik der Core Transformation und ihre Methode „The Wholeness Work“, die Selbstbetrachtung aus
verschiedenen Ebenen des Selbst ermöglicht. Beide Techniken können zu sehr tiefen und intensiven seelischen Prozessen, zu innerer Balance, Ruhe und Gelassenheit
führen.
Connirae Andreas überzeugt mit ihrem tiefen Wissen, aber auch als Trainerin mit ihrem sanften, liebevollen Stil. Sie inspiriert bis heute viele Coaches,
Trainer und Therapeuten in ihren Workshops. ⮞ Mehr zur Methode
Eine bedeutende Erweiterung der NLP-Methodik hat auch der Sozialpsychologe Lucas Derks (Bild) geleistet. In dem Sozialen Panorama beschreibt er, wie Menschen
soziale Beziehungen im inneren Bild repräsentieren.
Das geschieht in einer Art von Panorama, einer Struktur, in der das eigene Selbst(bild) zentral steht und von den Menschen umgeben ist, zu denen es eine wichtige
Beziehung hat, sowohl biologisch als auch durch verschiedenste Arten von Bindungen. So bildet nach Derks der Mensch innerlich seinen sozialen Kontext ab.
 Jede Person hat in diesem System eine feststehende Position, einen exakt definierten Ort.
Jede Person hat in diesem System eine feststehende Position, einen exakt definierten Ort.
Er bringt das auf die Formel: Beziehung ist gleich Lokalisierung.
Anders ausgedrückt: Die Veränderung der Position eines Menschen in dieser Struktur verändert auch die Art und die Qualität bzw. Intensität der Beziehung.
Diese soziale Ordnungsstruktur, das Panorama, steuert primär unser soziales Verhalten. Dabei unterscheidet er universelle, kulturelle und individuelle Interaktionen.
Natürlich laufen diese Repräsentationsprozesse weitestgehend unbewusst ab, können aber leicht in Trance visualisiert werden.
Auch Sachen und abstrakte Dinge sind im Sozialen Panorama repräsentiert, weil wir ja auch Beziehungen und Bindungen zu Dingen entwickeln.
Diese Objekte werden dann personalisiert (und damit zu Subjekten), ihnen werden Eigenschaften zugeschrieben, ihre Position wird festgelegt.
All diese Elemente im Panorama sind für Derks Teile des Bewusstseins der eigenen Person. ⮞ Mehr zur Methode
Lösungsorientierte / lösungsfokussierte Kurztherapie – LFK
Diese Methode wurde 1982 von den Psychotherapeuten Steve de Shazer und Insoo Kim Berg (Bild) vorgestellt. Ihr konstruktivistischer Ansatz ist, dass für die
Lösungsfindung die Wünsche, Ziele und Erfahrungen entscheidend sind.
 Dagegen sind die Problemursachen irrelevant für den Veränderungsprozess.
Der erfolgt nach ihrer Ansicht in kleinen Schritten. Fokussiert wird dabei auf das, was funktioniert, und auf positive Ausnahmen im Problemkontext. Dazu reichen wenige relevante Informationen aus.
Dagegen sind die Problemursachen irrelevant für den Veränderungsprozess.
Der erfolgt nach ihrer Ansicht in kleinen Schritten. Fokussiert wird dabei auf das, was funktioniert, und auf positive Ausnahmen im Problemkontext. Dazu reichen wenige relevante Informationen aus.
Radikal neu ist in diesem Konzept der Grundsatz der „Einfachheit“ (Simplicity), der auf der systemtheoretischen Annahme basiert, dass schon kleine Veränderungen
bei einem Einzelnen erhebliche Auswirkungen auf das Gesamtsystem und alle Beteiligten haben können. – Veränderungen in hochkomplexen Systemen brauchen keine komplexen
Methoden. Techniken der LFK werden häufig eingesetzt in Therapie, Beratung, Coaching, Sozialpädagogik und sogar der Seelsorge. Geradezu berühmt sind dabei die
„Wunderfrage“ und die „Skalenfrage“. ⮞ Mehr zur Methode
Hypnosystemische Therapie
Erleben wird erzeugt durch Aufmerksamkeitsfokussierung. Dieses Therapiekonzept wurde Anfang der 1980er-Jahre von Gunther Schmidt (Bild) geschaffen.
Schmidt arbeitet weniger mit klassischen Hypnose-Induktionen, sondern fokussiert in Dialogen auf Augenhöhe auf die Kompetenzen des Klienten und seine Ressourcen.
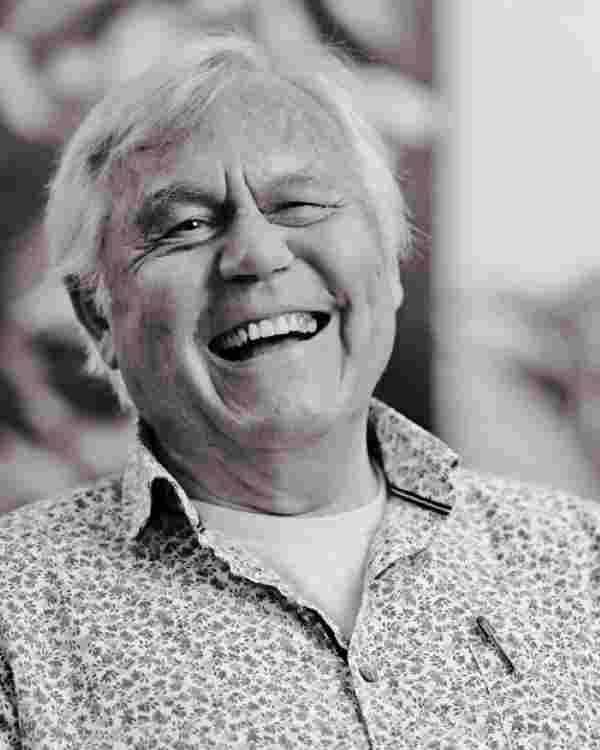 Entscheidend ist dabei, dass der Klient erkennt, dass er in unwillkürlichen Prozessen, einer Art Selbsthypnose (Problemtrance), seine Gestaltungsspielräume einengt und selbst die Problemsymptomatik erzeugt, unter der er leidet. Gleichzeitig geben die
Symptome oft metaphorische Hinweise auf Lösungsmöglichkeiten. Der Therapeut kann die Mitteilungen des Klienten für eine „Lösungstrance“ nutzen und zielgerichtete
Autosuggestionen anstoßen, die Wahlmöglichkeiten erkennbar machen.
Entscheidend ist dabei, dass der Klient erkennt, dass er in unwillkürlichen Prozessen, einer Art Selbsthypnose (Problemtrance), seine Gestaltungsspielräume einengt und selbst die Problemsymptomatik erzeugt, unter der er leidet. Gleichzeitig geben die
Symptome oft metaphorische Hinweise auf Lösungsmöglichkeiten. Der Therapeut kann die Mitteilungen des Klienten für eine „Lösungstrance“ nutzen und zielgerichtete
Autosuggestionen anstoßen, die Wahlmöglichkeiten erkennbar machen.
Dieser Ansatz basiert u. a. auf der Hypnotherapie nach Milton Erickson und der systemischen Familientherapie und neuen Erkenntnissen der Hirnforschung. Dabei wird
betrachtet, was ein Einzelner erlebt, wie er/sie diese Erfahrung bewertet und welche Auswirkungen das hat. Im Zentrum steht dabei, wie die „Innere Welt“ des Klienten
mit seiner äußeren Welt interagiert (systemische Wechselwirkung).
🔑
Wichtig ist: Die Fokussierung der Aufmerksamkeit – weg vom engen Problemfokus – hin auf andere, attraktive Möglichkeiten.
Ich schätze Gunther Schmidt für seine sehr verständnisvollen, wertschätzenden Dialoge, seinen Einsatz von lebendigen Bildern, Metaphern und kreativen Sprachmustern,
die spielerisch leicht zu Lösungstrancen „einladen“, wie er sagt. Gunther Schmidt ist auch als Mediziner ein Pionier der psychosomatischen Therapie und als Ökonom
erfolgreich im Businesscoaching und leitet zahlreiche Fortbildungen. ⮞ Mehr zur Methode

 Aus systemisch-konstruktivistischer Sicht ist das jedoch anders. Hier erleben wir Wirklichkeit als einen Prozess, den wir selbst führen, den jede/r auf ganz
individuelle Art selbst gestaltet. Jede/r formt sein/ihr Selbstbild, steuert das Verhalten und entscheidet mit, was geschieht. So ist jede/r Schöpfer/in der eigenen,
subjektiven Welt! Du bist nicht „Opfer der Umstände“, ein Produkt der Welt außerhalb von dir – du bist selbst verantwortlich.
Aus systemisch-konstruktivistischer Sicht ist das jedoch anders. Hier erleben wir Wirklichkeit als einen Prozess, den wir selbst führen, den jede/r auf ganz
individuelle Art selbst gestaltet. Jede/r formt sein/ihr Selbstbild, steuert das Verhalten und entscheidet mit, was geschieht. So ist jede/r Schöpfer/in der eigenen,
subjektiven Welt! Du bist nicht „Opfer der Umstände“, ein Produkt der Welt außerhalb von dir – du bist selbst verantwortlich.
 Erfahrungen genutzt und welche Verhaltensmuster eingesetzt werden.So können wir die Welt erleben, empfinden und uns bewusst verhalten.
Vor allem erschaffen wir so ein kohärentes Selbstbewusstsein, unser eigenes Ich!
Erfahrungen genutzt und welche Verhaltensmuster eingesetzt werden.So können wir die Welt erleben, empfinden und uns bewusst verhalten.
Vor allem erschaffen wir so ein kohärentes Selbstbewusstsein, unser eigenes Ich! und Entscheidungsproblemen melden?
Da kann man Anteile wie den inneren Kritiker, den Antreiber, das innere Kind, den kreativen Anteil, den inneren Wächter oder viele andere identifizieren.
und Entscheidungsproblemen melden?
Da kann man Anteile wie den inneren Kritiker, den Antreiber, das innere Kind, den kreativen Anteil, den inneren Wächter oder viele andere identifizieren.



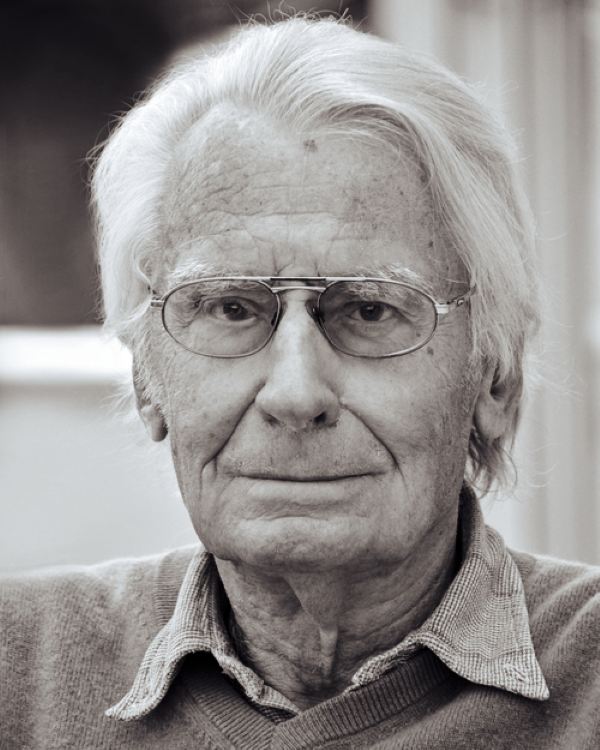 die bekannte „Heidelberger Schule“,
die maßgeblich die systemische Methodik im Land geprägt hat.
die bekannte „Heidelberger Schule“,
die maßgeblich die systemische Methodik im Land geprägt hat.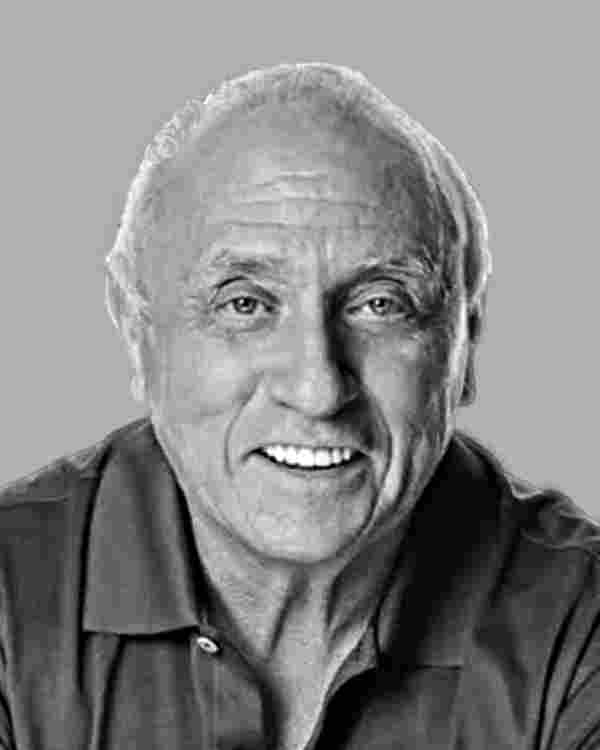 NLP wurde von dem Mathematiker Richard Bandler (Bild) und dem Linguisten John Grinder u. a. in den 1970er Jahren in Palo Alto entwickelt, sie wurden
dabei von Gregory Bateson gefördert. Sie definierten NLP als „das Studium über die Struktur subjektiver Erfahrung“.
NLP wurde von dem Mathematiker Richard Bandler (Bild) und dem Linguisten John Grinder u. a. in den 1970er Jahren in Palo Alto entwickelt, sie wurden
dabei von Gregory Bateson gefördert. Sie definierten NLP als „das Studium über die Struktur subjektiver Erfahrung“.
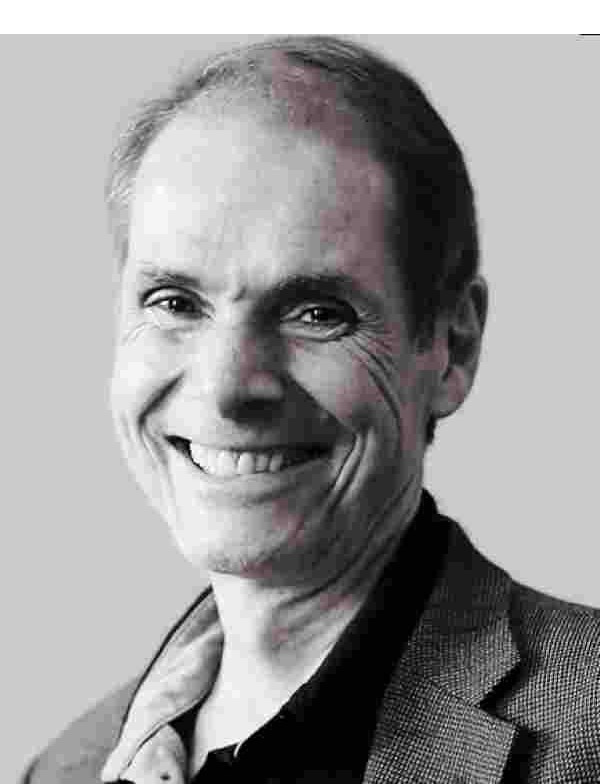
 Neue Ideen zur Ausweitung von NLP hat auch die promovierte Psychotherapeutin Connirae Andreas (Bild) zusammen mit ihrem Mann Steve Andreas
eingebracht. Bekannt ist vor allem die wunderbare Technik der Core Transformation und ihre Methode „The Wholeness Work“, die Selbstbetrachtung aus
verschiedenen Ebenen des Selbst ermöglicht. Beide Techniken können zu sehr tiefen und intensiven seelischen Prozessen, zu innerer Balance, Ruhe und Gelassenheit
führen.
Neue Ideen zur Ausweitung von NLP hat auch die promovierte Psychotherapeutin Connirae Andreas (Bild) zusammen mit ihrem Mann Steve Andreas
eingebracht. Bekannt ist vor allem die wunderbare Technik der Core Transformation und ihre Methode „The Wholeness Work“, die Selbstbetrachtung aus
verschiedenen Ebenen des Selbst ermöglicht. Beide Techniken können zu sehr tiefen und intensiven seelischen Prozessen, zu innerer Balance, Ruhe und Gelassenheit
führen. Jede Person hat in diesem System eine feststehende Position, einen exakt definierten Ort.
Jede Person hat in diesem System eine feststehende Position, einen exakt definierten Ort.  Dagegen sind die Problemursachen irrelevant für den Veränderungsprozess.
Der erfolgt nach ihrer Ansicht in kleinen Schritten. Fokussiert wird dabei auf das, was funktioniert, und auf positive Ausnahmen im Problemkontext. Dazu reichen wenige relevante Informationen aus.
Dagegen sind die Problemursachen irrelevant für den Veränderungsprozess.
Der erfolgt nach ihrer Ansicht in kleinen Schritten. Fokussiert wird dabei auf das, was funktioniert, und auf positive Ausnahmen im Problemkontext. Dazu reichen wenige relevante Informationen aus.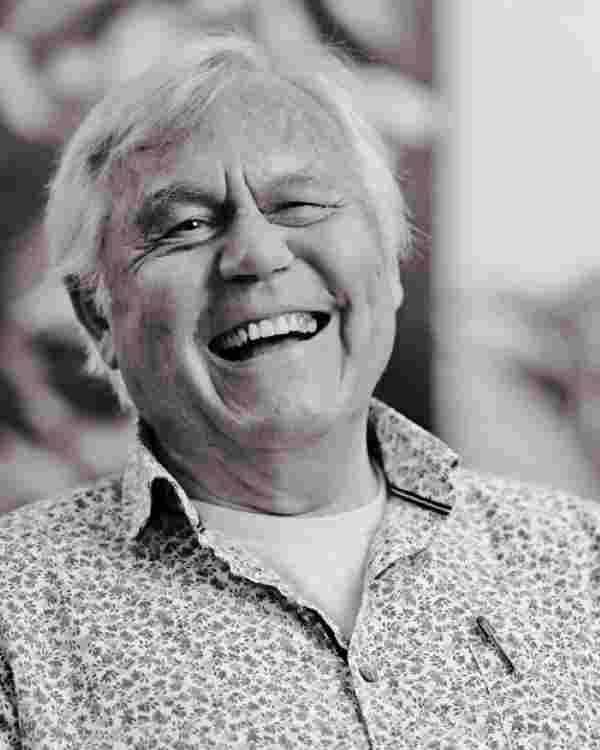 Entscheidend ist dabei, dass der Klient erkennt, dass er in unwillkürlichen Prozessen, einer Art Selbsthypnose (Problemtrance), seine Gestaltungsspielräume einengt und selbst die Problemsymptomatik erzeugt, unter der er leidet. Gleichzeitig geben die
Symptome oft metaphorische Hinweise auf Lösungsmöglichkeiten. Der Therapeut kann die Mitteilungen des Klienten für eine „Lösungstrance“ nutzen und zielgerichtete
Autosuggestionen anstoßen, die Wahlmöglichkeiten erkennbar machen.
Entscheidend ist dabei, dass der Klient erkennt, dass er in unwillkürlichen Prozessen, einer Art Selbsthypnose (Problemtrance), seine Gestaltungsspielräume einengt und selbst die Problemsymptomatik erzeugt, unter der er leidet. Gleichzeitig geben die
Symptome oft metaphorische Hinweise auf Lösungsmöglichkeiten. Der Therapeut kann die Mitteilungen des Klienten für eine „Lösungstrance“ nutzen und zielgerichtete
Autosuggestionen anstoßen, die Wahlmöglichkeiten erkennbar machen.

 und Naturwissenschaften auf einzigartige Weise. Seine Forschungen umfassten Anthropologie, Ökologie, Naturphilosophie, Erkenntnistheorie, Lerntheorie,
Bateson gilt als Mitbegründer der Systemtheorie und Kybernetik und wird oft als Vater der systemischen Therapien bezeichnet.
und Naturwissenschaften auf einzigartige Weise. Seine Forschungen umfassten Anthropologie, Ökologie, Naturphilosophie, Erkenntnistheorie, Lerntheorie,
Bateson gilt als Mitbegründer der Systemtheorie und Kybernetik und wird oft als Vater der systemischen Therapien bezeichnet. 

 Heinz von Foerster (* 1911–2002) ist ein österreichischer Physiker, Kybernetiker und Philosoph und Mitbegründer des Radikalen Konstruktivismus.
Er lehrte als Professor für Biophysik und forschte an seinem Biological Computer Laboratory (unter anderem mit dem Mathematiker Norbert Wiener, dem Gründer der Kybernetik,
und dem Erfinder des Computers John von Neumann). Natürlich hatte er auch enge Verbindungen zu Bateson und Watzlawick. Von Foerster war ein vielseitiger Forscher,
Denker und kreativer Querdenker. In „Die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners“ verrät er viel über seine Denkweise, ein lesenswertes Buch.
Heinz von Foerster (* 1911–2002) ist ein österreichischer Physiker, Kybernetiker und Philosoph und Mitbegründer des Radikalen Konstruktivismus.
Er lehrte als Professor für Biophysik und forschte an seinem Biological Computer Laboratory (unter anderem mit dem Mathematiker Norbert Wiener, dem Gründer der Kybernetik,
und dem Erfinder des Computers John von Neumann). Natürlich hatte er auch enge Verbindungen zu Bateson und Watzlawick. Von Foerster war ein vielseitiger Forscher,
Denker und kreativer Querdenker. In „Die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners“ verrät er viel über seine Denkweise, ein lesenswertes Buch.  erarbeit. Beide haben gemeinsam. dass sie Österreicher sind und nach dem Krieg in die USA auswanderten.
Als Philosoph und Kommunikationswissenschaftler und hatte natürlich auch Kontakt mit der Palo-Alto-Gruppe.
Er hat sich wie Foerster mit dem Realitätsbegriff, Musterverarbeitung und kognitiven Prozessen auseinandergesetzt. Objektive Wahrheit gibt es
für ihn nicht, er betont stattdessen die Bedeutung von Viabilität: Das bedeutet, dass etwas real ist, wenn es brauchbar oder nützlich ist und vor allem, wenn es funktioniert.
Was sich im praktischen Handeln bewährt und Probleme löst, hat besondere Bedeutung.
Diese Zitate sprechen für sein konstruktivistisches Denken:
erarbeit. Beide haben gemeinsam. dass sie Österreicher sind und nach dem Krieg in die USA auswanderten.
Als Philosoph und Kommunikationswissenschaftler und hatte natürlich auch Kontakt mit der Palo-Alto-Gruppe.
Er hat sich wie Foerster mit dem Realitätsbegriff, Musterverarbeitung und kognitiven Prozessen auseinandergesetzt. Objektive Wahrheit gibt es
für ihn nicht, er betont stattdessen die Bedeutung von Viabilität: Das bedeutet, dass etwas real ist, wenn es brauchbar oder nützlich ist und vor allem, wenn es funktioniert.
Was sich im praktischen Handeln bewährt und Probleme löst, hat besondere Bedeutung.
Diese Zitate sprechen für sein konstruktivistisches Denken:
 Sie findet Anwendung in den Natur- und Geisteswissenschaften, etwa in Biologie, Psychologie, Therapie, Coaching, Organisationsentwicklung oder Kommunikationswissenschaft.
Kern des Ansatzes ist die Abkehr vom linearen Ursache-Wirkungs-Denken. Entwicklungen werden nicht als eindimensionale Abfolge, sondern als Ergebnis von Wechselwirkungen
in zirkulären Prozessen verstanden. Systeme werden daher als Ganzheiten betrachtet, deren Eigenschaften sich nicht allein aus der Summe der Einzelteile erklären lassen.
Mit diesem Metakonzept eröffnete die Systemtheorie neue Möglichkeiten, Dynamiken in Familien, Gruppen, Organisationen oder Gesellschaften zu beschreiben und zu verstehen.
Sie findet Anwendung in den Natur- und Geisteswissenschaften, etwa in Biologie, Psychologie, Therapie, Coaching, Organisationsentwicklung oder Kommunikationswissenschaft.
Kern des Ansatzes ist die Abkehr vom linearen Ursache-Wirkungs-Denken. Entwicklungen werden nicht als eindimensionale Abfolge, sondern als Ergebnis von Wechselwirkungen
in zirkulären Prozessen verstanden. Systeme werden daher als Ganzheiten betrachtet, deren Eigenschaften sich nicht allein aus der Summe der Einzelteile erklären lassen.
Mit diesem Metakonzept eröffnete die Systemtheorie neue Möglichkeiten, Dynamiken in Familien, Gruppen, Organisationen oder Gesellschaften zu beschreiben und zu verstehen.
 dass Menschen ihre Wirklichkeit nicht „vorfinden“, sondern aktiv konstruieren. Realität entsteht durch individuelle Wahrnehmung, Interpretation und soziale Kontexte.
Objektive Wahrheit im strengen Sinn gibt es demnach nicht, sondern vielfältige subjektive Wirklichkeiten, die durch persönliche Erfahrungen, Wissen, Überzeugungen und
kulturelle Einflüsse geformt sind. Sprache und Kommunikation spielen dabei eine zentrale Rolle. In Pädagogik, Psychotherapie und Coaching eröffnet dieser Ansatz neue
Perspektiven: Veränderung entsteht nicht durch das Vermitteln einer „richtigen“ Sichtweise von außen, sondern durch die individuelle Konstruktion neuer Bedeutungen.
Der Konstruktivismus macht so deutlich, dass Unterschiedlichkeit und Perspektivenvielfalt wertvolle Ressourcen sein können.
dass Menschen ihre Wirklichkeit nicht „vorfinden“, sondern aktiv konstruieren. Realität entsteht durch individuelle Wahrnehmung, Interpretation und soziale Kontexte.
Objektive Wahrheit im strengen Sinn gibt es demnach nicht, sondern vielfältige subjektive Wirklichkeiten, die durch persönliche Erfahrungen, Wissen, Überzeugungen und
kulturelle Einflüsse geformt sind. Sprache und Kommunikation spielen dabei eine zentrale Rolle. In Pädagogik, Psychotherapie und Coaching eröffnet dieser Ansatz neue
Perspektiven: Veränderung entsteht nicht durch das Vermitteln einer „richtigen“ Sichtweise von außen, sondern durch die individuelle Konstruktion neuer Bedeutungen.
Der Konstruktivismus macht so deutlich, dass Unterschiedlichkeit und Perspektivenvielfalt wertvolle Ressourcen sein können. Kommunikation und Selbstorganisation in lebenden Organismen, technischen Systemen sowie in sozialen, ökonomischen und politischen Strukturen.
Ein zentrales Prinzip ist das Konzept der Rückkopplung: Systeme regulieren ihr Verhalten durch Rückmeldungen und passen sich dadurch an veränderte Bedingungen an.
Dieser Gedanke prägt nicht nur Technik und Informatik, sondern auch das Verständnis von Lern- und Veränderungsprozessen im menschlichen Handeln.
Kommunikation und Selbstorganisation in lebenden Organismen, technischen Systemen sowie in sozialen, ökonomischen und politischen Strukturen.
Ein zentrales Prinzip ist das Konzept der Rückkopplung: Systeme regulieren ihr Verhalten durch Rückmeldungen und passen sich dadurch an veränderte Bedingungen an.
Dieser Gedanke prägt nicht nur Technik und Informatik, sondern auch das Verständnis von Lern- und Veränderungsprozessen im menschlichen Handeln.