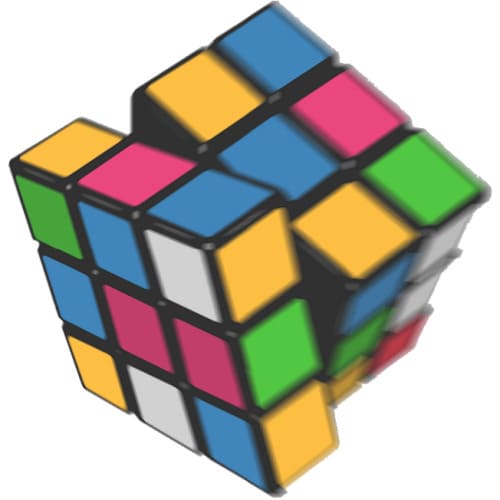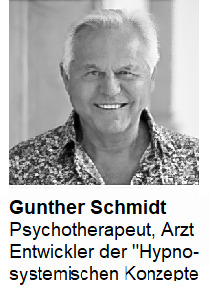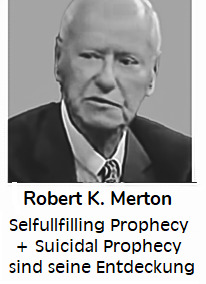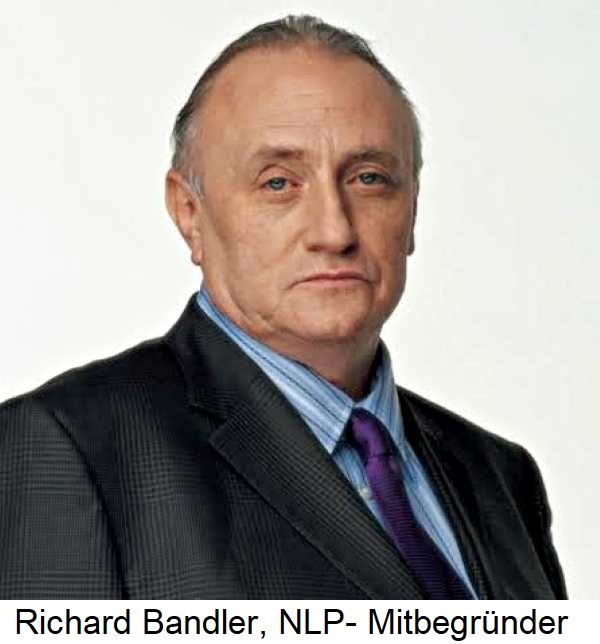Die Wirklichkeit erleben wir nur jetzt

In der Lösungsfokussierten Kurztherapie (LFK) ist die Akzeptanz, das Annehmen/Anerkennen dessen, „was ist“, Voraussetzung für nachhaltige Veränderung.
„Nur das radikale Akzeptieren der Gegebenheiten in unserem Leben erlaubt uns eine Veränderung.“ (M. Linehan)
Über die Richtigkeit dieser Behauptung kann man streiten. Natürlich kann man immer versuchen,
anstelle dessen, was jetzt geschieht, etwas anderes zu initiieren bzw. statt der einen Handlungsweise etwas anderes zu tun und das als Veränderung zu bezeichnen.
Oft geschieht das durch neue Zielsetzungen, und dadurch kann die Lösung eines aktuellen Problems dann in der Zukunft erwartet werden.
Das wird positiv reframed als „zielgerichtetes Verhalten“ und keinesfalls als Verschieben,
Verdrängen oder gar Versagen gewertet. Wer etwas nicht aushalten will und dann etwas Neues tut, gilt meist als aktiv, aufgeschlossen und mutig – nicht als Vermeider.
Genau das geschieht häufig im zielorientierten Coaching.
Das wäre aber nicht die Veränderung/Neugestaltung eines bestehenden Prozesses, sondern der Beginn eines neuen Prozesses, ohne den alten abzuschließen, und ich vermute,
dass Marsha Linehan das gemeint hat. Warum soll es denn so wichtig sein, Geschehen achtsam zu durchleben, aktiv anzunehmen oder laufende Prozesse auszuhalten
und zu würdigen und dann entweder anders weiterzuführen oder abzuschließen?
Aus der Hirnforschung ist bekannt, dass das Großhirn unvollständige Muster, Strukturen und Prozesse möglichst vervollständigen bzw. abschließen, bewerten und
einordnen möchte. Unabgeschlossene Prozesse können im Unbewussten – auch über lange Zeit – in Endlosschleifen weiterlaufen.
Manchmal erleben wir das auch bewusst; dann kann das quälend, zermürbend und schädlich für uns sein. Auf jeden Fall ist es Stress für das Gehirn.
Deshalb macht das Sprichwort „Der einzige Weg hinaus ist der Weg hindurch“ Sinn.
Das Abschließen von Prozessen und das Aushalten von Problemen, das Durchleben emotionaler Phasen, steigert nachweislich unsere Resilienz. Und abgeschlossene,
schwierige Erlebnisse sind Lernerfahrungen. Dadurch wird Selbstkompetenz entwickelt, werden Bewältigungsstrategien trainiert und das Selbstvertrauen gestärkt.
So kann es gelingen, selbst leidvolle Erfahrungen in wertvolle Ressourcen zu transformieren.
Veränderungen haben oft einen Preis, aber auch einen Gewinn, und der Versuch, der Gegenwart zu entkommen und stattdessen verlockende Zukunftsziele zu konstruieren,
ist oft nicht der sinnvollste.
Achtsamkeit und Aufmerksamkeit
„Dort, wo die Aufmerksamkeit hingeht, geschieht etwas“, sagt Albert Einstein. „Der Beobachter beeinflusst das Experiment“, sagt die Quantenphysik, und
„Beobachter wirken auf das betrachtete System“, sagt die Systemtheorie. Das gilt natürlich auch für die Selbstbeobachtung. Achtsam wahrzunehmen ist also nicht nur
ein passiver Vorgang, sondern schafft einen Impuls, mit dem ein Veränderungsprozess beginnt – und zwar jetzt, sofort, nicht erst beim Erreichen eines zukünftigen Ziels!
Die Neurobiologie postuliert, dass es für das Gehirn eigentlich nur Gegenwart gibt. Wir haben keine Erinnerungen fest abgespeichert, sondern konstruieren die vermeintliche
Vergangenheit ständig neu im Jetzt – genauso wie Zukunftserwartungen, die auch nur Als-ob-Konstruktionen sind! Zukunftsziele haben unsere Zivilisation und Technologie
stark vorangebracht. Sie motivieren und fordern uns zu ständig mehr Leistung und ökonomischem Wachstum.
Der Nachteil dabei ist jedoch, dass Menschen nur einen sehr begrenzten Aufmerksamkeitsfokus haben. Wer sich stark auf das ausrichtet, was (hoffentlich) kommt, kann nicht
gut wahrnehmen, was jetzt gerade geschieht. Ein weiterer Nachteil ist, dass ein Zukunftsziele-Konzept zwangsläufig zum „Immer-mehr-haben-wollen“ führt – und nicht zur
Zufriedenheit mit dem aktuellen Ist-Zustand. Damit kann sich diese Kultur selbst zerstören.
Mit Achtsamkeit und feinsinniger Wahrnehmung können wir in unserem Innern und in unserem Lebenssystem einen Reichtum an
Ideen, Kreativität und Möglichkeiten entdecken, der unerschöpflich ist und uns eine sinnerfüllte Wirklichkeit schenken kann.
Toleranz und Akzeptanz
Im Gegensatz zur Toleranz, die ein passives Hinnehmen bedeutet, ist Akzeptanz eine aktive, freiwillige Zustimmung, der ein Abwägungs- bzw. Beurteilungsprozess vorausgeht.
Akzeptanz ist somit vielleicht der etwas anspruchsvollere Weg als die bloße Toleranz oder das einfache Mitmachen von Trends und Entwicklungen im sozialen
und ökonomischen Kontext. Es bedeutet, sich selbstverantwortlich zu entscheiden.
Veränderungsprozesse oder eine Neuorientierung aus einer Situation heraus, die zuvor genau betrachtet, bewertet und akzeptiert wurde,
haben eine andere Qualität als eine Entwicklung, die einfach ein „Weg vom Problem“ hin zur vermeintlich besseren zukünftigen Lösung führt.
In systemischen Prozessen, vor allem auch bei der Aufstellungsarbeit, ist die Würdigung und Akzeptanz dessen, was sich dort zeigt, ein entscheidender
Teil der Lösungsarbeit.
Akzeptanz-orientiertes Coaching
Zwar werde ich hier keinen fertigen Coachingansatz vorstellen, aber ich werde ein paar Hinweise
geben, wie man dabei vorgehen könnte.
Wenn das Coaching nicht primär zielorientiert, sondern akzeptanzorientiert ist, wird das Risiko von Fehlentscheidungen minimiert. Denn hier geht es zunächst darum,
dass Klient:innen ihre Situation sehr achtsam anschauen und sich auf das, was Fakt ist, wirklich einlassen – auch auf das zunächst unangenehm,
schmerzlich, beängstigend Erscheinende – und es aushalten und würdigen, möglichst ohne Bewertungen, Schuldzuweisungen und Rechtfertigungen.
Erst indem man das, was geschieht, so annimmt, wie es ist, selbst wenn man es nicht verursacht hat, wird man wirklich frei. Und dann kann man klar
entscheiden, ob es annehmbar ist, wie es ist, oder ob Veränderung sinnvoll, notwendig oder überhaupt möglich ist. Vielleicht reicht schon eine andere
leicht geänderte Betrachtungsweise, eine geringe Modifikation, und schon erscheint alles anders
– ohne substanzielle Veränderung! Das wäre auch ökonomisches Coaching!
Die Lösungsfokussierte Kurztherapie (LFK) bietet einige Techniken, die als Basics für ein solches Coachingkonzept dienen können. In der LFK wird grundsätzlich
nicht nach Ursachen in der Vergangenheit geschaut – ebenso wenig wie auf fernere Zukunftsziele. Sie ist klar gegenwartsbezogen und testet Interventionen danach, wie sie
den Ist-Zustand verändern. LFK ist eine Methode, in der Achtsamkeit und Respekt fundamental sind und Ansichten sowie Mitteilungen von
Klient:innen akzeptiert und nicht kritisch hinterfragt werden. Lösungen werden durch Lernprozesse erreicht, die aus dem Vergleich unterschiedlicher Verhaltensmuster
der Klient:innen entstehen.
Akzeptanz in systemischen Aufstellungen

Beim Akzeptanzprozess geht es nicht primär darum, etwas Neues zu erreichen; Veränderung und Lösung liegen in der eingehenden Wahrnehmung
des Ist-Zustandes, der letztlich oft nicht mehr als Problem empfunden wird. Das Prozessergebnis muss nicht strikt positiv ausfallen,
es reicht oft auch ein neutrales: „Es ist, wie es ist“ bzw. „Es ist ok so“ – nicht als Ausdruck der Resignation, sondern als Bestätigung: Jetzt kann ich es
ohne Widerstand annehmen und als Lernerfahrung integrieren.
Dieses Akzeptanzformat finden wir auch in der klassischen Strukturaufstellung, ausführlich beschrieben z. B. bei Hellinger oder Varga von Kibéd und Sparrer.
Basis dieser Aufstellungsarbeit ist erstens: zu schauen, was ist, und zweitens: zu würdigen/akzeptieren, wie es ist.
Darauf erfolgt häufig (muss aber nicht) als dritter Schritt das Ausprobieren von Strukturveränderungen, bis eine sogenannte Lösungsstruktur gefunden ist.
Das Würdigen und Annehmen dessen, was sich im Prozess zeigt, ist maßgeblich für dessen Gelingen. „Würdigen“ meint hier nicht unbedingt eine per se positive Sicht,
sondern kann schlicht bedeuten, dass überhaupt hingesehen werden kann, andere Beziehungsmuster und Dynamiken erlaubt und möglich sind
und Erstarrtes in Bewegung gerät.
Diese Elemente der Strukturarbeit sind nach meiner Auffassung wesentlicher Bestandteil des systemischen Coachings. Achtsamkeit und Akzeptanz
sind das Ergebnis eines subtilen Wahrnehmungsprozesses; sie bedingen einander wechselseitig. Hierzu meine Definition:
„Achtsamkeit ist eine besondere Form der Aufmerksamkeitsfokussierung. Im inneren Erleben geht es nicht nur um die präzise Wahrnehmung
der Submodalitäten (wie im NLP-Wahrnehmungsmodell beschrieben), sondern hier spielen das Empfinden des ‘Hier und Jetzt’ und die nichtwertende
Betrachtung (wie z. B. im Zen beschrieben) eine zentrale Rolle.“
Natürlich hat Achtsamkeit in Coachingprozessen grundsätzlich große Bedeutung (Kalibrieren), unabhängig von der angewandten Methodik.
Hier geht es jedoch um eine spezifische Form des aufmerksamen Wahrnehmens, die nicht einfach erfolgt, sondern Ergebnis einer präzisen Anleitung ist.
Aufmerksamkeit und Akzeptanz in der hypnosystemischen Methode
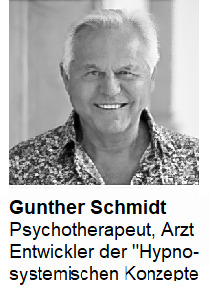
Die Fokussierung der Aufmerksamkeit ist auch das zentrale Element des hypnosystemischen Konzepts von Gunther Schmidt. Dabei wird davon ausgegangen,
dass Probleme durch selbsthypnotische Fokussierungen beim Coachee entstehen und stabilisiert werden.
Diese „Problemerzeugung“ wird dabei auch als Ergebnis von Kompetenzen gesehen, die den Klient:innen bewusst gemacht werden. Auch hier geht es um die Würdigung
und Akzeptanz des erreichten Ist-Zustandes. Der Coachee soll seine eigene Steuerungskompetenz und Selbstwirksamkeit erleben.
Dadurch wird eine Umfokussierung weg vom Problem möglich, neuronale Netzwerke werden aktiviert und mögliche
Lösungsmuster werden erkennbar. Letztlich wird die Problemtrance so zur Lösungstrance transformiert, und der Klient erlebt seine eigene Steuerungskompetenz.
In der Hypnosystemik ist der Fokus natürlich in der Gegenwart, da Vergangenheit und Zukunft lediglich als Hilfskonstruktionen gesehen werden,
die der narrativen Identitätsentwicklung dienen. Auch bei dieser Methodik geht es vornehmlich um Achtsamkeit/Aufmerksamkeit, Selbstakzeptanz
und das Erleben der Selbstwirksamkeit. Dadurch werden Lösungsmöglichkeiten „eingeladen“, wie Schmidt sagt.
ACT – die Akzeptanz- und Commitmenttherapie
Die Verbindung von achtsamer Beobachtung und Akzeptanz von Leid erzeugenden Motiven ist zentraler Teil der Methode in der Akzeptanz- und
Commitment-Therapie (ACT), die zu den achtsamkeitsbasierten Methoden der Verhaltenstherapie gehört. ACT ist ein handlungsorientierter Psychotherapie-
Ansatz, der in den letzten Jahren vor allem in Amerika und Australien entwickelt wurde. Er kann als Brücke zwischen der Systemischen Therapie und
der Verhaltenstherapie verstanden werden. Die Schwerpunkte dieses Ansatzes, der auf Achtsamkeitspraxis basiert, sind die Arbeit mit Akzeptanz und
Werten sowie die konkrete Umsetzung dieser Themen durch eigenes Handeln.
ACT regt dazu an, den Umgang mit Leiden neu zu erleben – verbunden mit Anerkennung, Akzeptanz und dem Vorhaben, sich vom Leiden nicht davon
abhalten zu lassen, das Leben zu leben, das ich leben möchte.
Kritik des ACT-Konzepts

Das Konzept dieser Therapieform ist für mich nicht ganz stimmig: Einerseits basiert ACT auf der Verhaltenstherapie mit ihren Wurzeln im Behaviorismus
und in der Verhaltensanalyse, andererseits arbeitet man mit Meditationstechniken und Hypnotherapie; einerseits traditionell problem- und defizitorientiert,
dann wieder mit moderneren lösungsorientierten Techniken, und gebraucht dabei (für mich seltsame) Kategorien wie „sauberes“ und „schmutziges“ Leid.
Dennoch finde ich, dass man mit einigen ACT-Techniken das systemische Coaching ergänzen und bereichern kann – zumal diese Techniken teilweise
der Hypnotherapie entlehnt und somit auch NLP-kompatibel sind. Letzten Endes geht es bei diesen Ansätzen um die Umfokussierung der Aufmerksamkeit
und die Auflösung der Verankerung von negativ wirkenden Repräsentationen. In der ACT nennt man diese Verankerung „kognitive Fusion“ und die Auflösung „Defusion“.
Im Zustand der Fusion sind wir mit schwierigen Gedanken und Gefühlen verhakt („hooked“) und unfrei; durch Defusion lösen wir uns aus der Verhakung
(„unhooked“) und werden frei, das zu tun, was uns wirklich wichtig ist. Dabei werden viele unterschiedliche Fusionsarten genannt.
Stets geht es darum, ungünstige Identifikationen zu lösen und negativen Mustern keine Macht über unser Leben zu geben. Leitsatz dazu:
„Denken Sie immer daran: Sie sind nicht Ihre Gedanken und Gefühle, sondern Sie haben sie! – Manche dieser Gedanken sind nützlich,
sehr viele jedoch ganz und gar nicht.“
Am Ende des ACT-Prozesses steht eine Zielorientierung, die mit der NLP-Zielentwicklung vergleichbar ist und ebenfalls auf den SMART-Kriterien beruht.
Wichtigster Punkt dabei ist das Commitment, die Selbstverpflichtung, sich an den eigenen Werten zu orientieren und innere Vereinbarungen sowie
definierte Ziele einzuhalten. Das kennen wir in ähnlicher Form auch im NLP.
Die Akzeptanz- und Commitmenttherapie gilt zwar als erfolgreiche Methode, ist aber nicht unumstritten, weil sie angeblich unwissenschaftliche
Elemente enthalte, die nicht verifizierbar und reproduzierbar sind. Schön, dass diese Schmähung nicht nur das NLP trifft. Dabei sind gerade diese
kritisierten Elemente – nämlich achtsames Wahrnehmen, Hier-und-Jetzt-Trance, Verankerungen lösen, Umfokussieren etc. – vermutlich mit die wirksamsten, die es gibt!
Gerade sie machen ACT, NLP, LFK und ähnliche Methoden so erfolgreich. Wie ärgerlich für die Kritiker!
Fazit
Meine Vorstellungen zum Akzeptanz-orientierten Coaching sollen nicht als etwas methodisch anderes und auch nicht als Infragestellung gängiger Konzepte
gesehen werden. Sie sind ein Angebot und Plädoyer, gewohnte und bewährte Verfahren zu ergänzen.
Damit meine ich, dass vor einer Zielsetzung und Neuausrichtung im Coachingprozess vielleicht öfter der Coachee ermuntert wird, seine aktuelle Situation,
seinen erreichten Ist-Zustand achtsam zu beobachten und zu würdigen, negative Bewertungen zu dissoziieren und zu akzeptieren, was jetzt gerade ist.
Denn genau hier erleben wir oft Unzufriedenheit, Hadern und Selbstabwertung der Klient:innen. Und dann kommt häufig (zu schnell) der Wunsch
nach Veränderung, neuen Zielen, dem vermeintlich Besseren, den Höchstleistungen.
Und – das ist meine Wahrnehmung – viele Coaches folgen diesen Wünschen allzu gerne. Dem Innehalten, Besinnen, der Selbstwürdigung des bisher Erreichten
wird dabei manchmal kaum Raum und Zeit gegeben.
Meine 20-jährige Erfahrung als Coach und systemischer Aufsteller zeigt mir immer wieder, wie wichtig dieser Schritt ist. Denn er löst Belastungen und Leid,
macht stolz auf die eigene bisherige Lebensleistung, stiftet inneren Frieden und schafft Freiraum für neue Möglichkeiten.
Dieser Zwischenschritt ist keine Zeitverschwendung, im Gegenteil! Nach der Akzeptanz erfolgen die nächsten Veränderungsschritte oft besonders zügig;
Freude, Mut, Klarheit, Kreativität und Motivation zeigen sich. Schön auch für den Coach.
Quelle: eurasiamed.de – ACT: Defusion